
KI - gekommen, um zu bleiben
Mit der Künstlichen Intelligenz stehen Wirtschaft und Gesellschaft vor einer der größten Herausforderungen der Geschichte - und vor einer ihrer größten Chancen.
von Dr. Ulrich Eberl
Vor allem das Sprach-, Text- und Bildverständnis von Maschinen mit KI leistet Erstaunliches: Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant und wie die virtuellen Assistenten alle heißen, lernen derzeit mit rasender Geschwindigkeit, Fragen und Befehle von Menschen zu verstehen und sinnvoll zu beantworten. Übersetzungsprogramme wie Google Translate oder DeepL können in Sekundenschnelle lange Textabschnitte in andere Sprachen übertragen. Das gelingt ihnen zwar noch nicht fehlerfrei, aber doch in einer so guten Qualität, wie sie noch vor ein, zwei Jahren unvorstellbar gewesen wäre.
In Kliniken, Banken und Unternehmen bereiten die ersten dieser neuen KI-Systeme bereits Daten auf und geben Ärzten, Finanzberatern und Managern Empfehlungen für Diagnosen, Geldanlagen oder die Optimierung von Industrieprozessen.
60 Jahre Auf und Ab in der KI-Forschung
Doch was sind die Treiber dieser Entwicklung? Wie ist es möglich, dass sich das Gebiet der Künstlichen Intelligenz in den vergangenen Jahren so explosionsartig entwickelt hat, und was ist an technischem Fortschritt in den nächsten Jahrzehnten noch vorstellbar? Könnten uns Maschinen dereinst sogar in allen Belangen übertreffen – wie es der jüngst verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking befürchtete, oder der Tesla-Gründer Elon Musk, der vor einer „Superintelligenz“ warnte, die uns vielleicht genauso behandeln würde, wie wir mit lästigen Mücken umgehen.
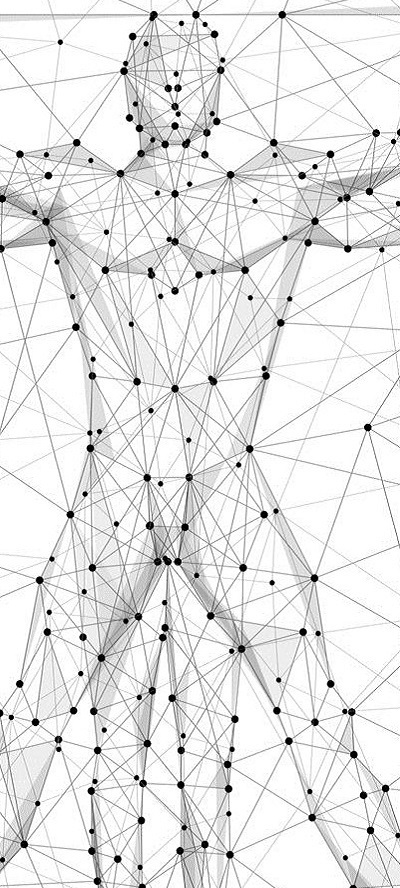
Um diese Fragen beantworten zu können, hilft zunächst ein Blick in die Vergangenheit. Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ stammt aus dem Jahr 1956, als der US-Wissenschaftler John McCarthy eine Konferenz in New Hampshire so betitelte. Auf dieser Tagung diskutierten Forscher erstmals über Computer, die Aufgaben lösen sollten, die über das reine Rechnen hinausgingen, etwa Texte analysieren, Sprachen übersetzen oder Spiele spielen. So hatte der Elektroingenieur Arthur Samuel für einen IBM-Großrechner ein Programm für das Brettspiel Dame geschrieben. Am Anfang kannte diese Software nur die erlaubten Züge des Spiels und sie verlor stets gegen Samuel. Doch dieser ließ ein weiteres Programm mitlaufen, das – entsprechend den Strategien, die er selbst kannte – bei jedem Zug die Gewinnwahrscheinlichkeit bewertete.
Zugleich hatte Samuel eine geniale Idee: Er ließ den Computer gegen sich selbst spielen und herausfnden, ob diese Wahrscheinlichkeiten geändert werden sollten.
Spiel für Spiel, immer wieder. Dabei lernte der Computer hinzu und verbesserte die Genauigkeit seiner Vorhersagen. Was dann passierte, scheint heute eine Selbstverständlichkeit, war 1956 aber eine Sensation: Der Computer wurde ein so guter Dame-Spieler, dass Samuel keine Chance mehr gegen ihn hatte. Ein Mensch hatte erstmals einer Maschine etwas beigebracht, bei dem sie durch stetiges Lernen
besser wurde als ihr eigener Lehrer.
Nach demselben Prinzip entwarfen die Forscher der GoogleTochter DeepMind 2017 ihr Programm AlphaGo Zero. Sie gaben ihm nur die Regeln des Go-Spiels vor und ließen es dann ständig gegen sich selbst spielen. Binnen drei Tagen erreichte AlphaGo Zero vom einfachsten Anfängerniveau die Spielstärke eines Profs und übertraf bereits die Version, die 2016 gegen den menschlichen Weltmeister Lee Sedol mit 4:1 gewonnen hatte. Nach drei Wochen verfügte AlphaGo Zero über eine Spielstärke, die noch nie ein Mensch in diesem jahrtausendealten Spiel erreicht hatte – und das, ohne dass das Programm jemals Spiele von Menschen studiert hätte.
Vorbild Gehirn
In der Geschichte der Künstlichen Intelligenz gab es allerdings auch viele Rückschläge, Hypes entstanden und verschwanden wieder. Doch seit Mitte der 1980er-Jahre das revolutionär neue Konzept der Neuronalen Netze seinen Aufschwung nahm – mit einem weiteren Boom in den vergangenen Jahren –, wächst auch die Zahl der kommerziellen Erfolgsgeschichten.
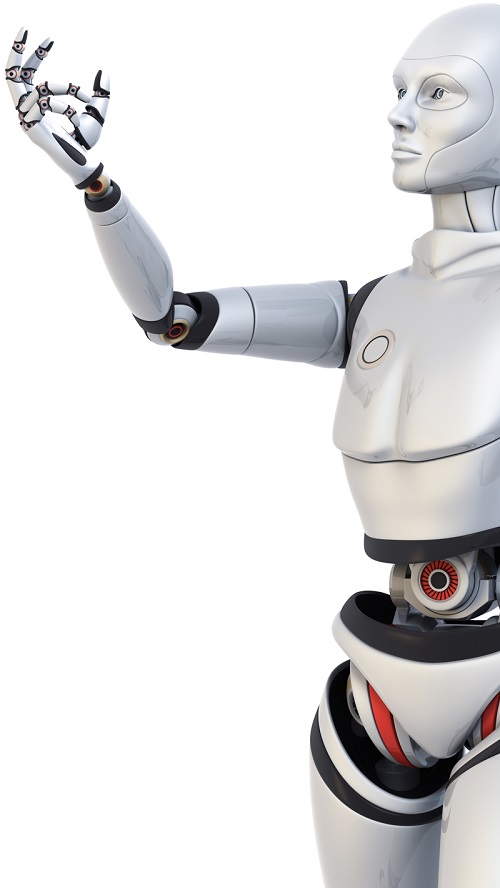
Ein Neuronales Netz orientiert sich, vereinfacht ausgedrückt, an der Funktionsweise der Nervenzellen, der Neuronen, im Gehirn. In ihm sind mehrere Schichten künstlicher Neuronen auf komplexe Weise miteinander verbunden, um Informationen zu verarbeiten. Da die Stärken dieser Verbindungen variieren können und auch Rückkopplungen möglich sind, sind diese Netze lernfähig.
Das Prinzip dahinter ist einfach: Wird eine Verbindung immer wieder benutzt, steigt ihre Verbindungsstärke und damit ihre Bedeutung – im Gehirn ist das genauso. Wenn wir oft genug gelernt haben, dass eine rote Ampel „Halt! Gefahr!“ bedeutet, dann ist diese Assoziation sofort da, wo immer wir eine rote Ampel sehen.
Insbesondere eignen sich solche Neuronalen Netze dazu, Muster zu erkennen, ohne dass ihnen vom Menschen einprogrammiert werden muss, an welchen exakten Eigenschaften der Muster sie dies festmachen sollen. Präsentiert man ihnen beispielsweise win einer Trainingsphase unzählige Fotos von Bäumen, Katzen oder Autos, können sie anschließend auch auf unbekannten Bildern sofort Bäume, Katzen oder Autos identifzieren. Ebenso kann man sie mit gesprochenen Worten oder Schriftzeichen trainieren, und sie können danach Sprachbefehle oder Handschriften erkennen. Was die heutigen, sogenannten Deep-Learning-Systeme von den Neuronalen Netzen der 1980er-Jahre unter scheidet, ist vor allem ihre Leistungsstärke: Waren damals nur einige Tausend künstliche Neuronen in wenigen Schichten miteinander verbunden, so sind es bei den besten Systemen von heute Milliarden von Neuronen, die in bis zu 30 Schichten gestapelt sind. Möglich machte diesen Fortschritt die enorme Steigerung der Rechenleistung und Speicherfähigkeit von Computern.
Die stärksten Supercomputer bewältigten Mitte der 1990erJahre etwa 100 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde – das schafft heute jedes gute Smartphone. Wir tragen also sozusagen einen Supercomputer von 1995 in unseren Jackentaschen. Zugleich sanken die Kosten um den Faktor 10.000, und das heutige Smartphone braucht nur ein 10.000stel bis ein 100.000stel der elektrischen Leistung damaliger Superrechner.
Auch Kameras und Sensoren werden immer kleiner und kostengünstiger. Und die Datenexplosion im Internet bietet eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Lernbeispielen. Derzeit werden von Menschen und Maschinen täglich zehnmal mehr neue Daten produziert, als in allen Büchern der Welt enthalten sind. All die Milliarden von Bildern, Texten, Videos und Audiodateien lassen sich als perfektes Trainingsmaterial für smarte Maschinen nutzen. Dadurch lernen sie immer besser sehen, lesen und sprechen. Mit jeder Suchanfrage, mit jeder Spracheingabe, mit jedem Übersetzungswunsch lernen sie hinzu.
Vertausendfachung der Leistungsstärke bis 2040
Diese Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Prozessoren und andere elektronische Bauteile haben das Potenzial für eine weitere Leistungssteigerung um den Faktor 1.000 bis zum Jahr 2040 – bei zugleich sinkenden Preisen. Und selbst das könnte noch übertroffen werden. Denn Forscher entwickeln derzeit sogenannte neuromorphe Chips, die das Verhalten von Nervenzellen nicht per Software, sondern elektronisch nachbilden: Deren Lernvorgänge sind bereits heute zehntausendfach schneller als beim menschlichen Gehirn und millionenfach schneller als bei Supercomputern. Wollte man mit heutigen Superrechnern die neuronalen Prozesse eines einzigen biologischen Tages nachbilden, bräuchte man dafür Jahre – Neurochips schaffen das in zehn Sekunden, allerdings bisher nur in Netzwerken mit etwa einer Million Nervenzellen, noch nicht mit Milliarden. Doch die Forschung steht hier erst am Anfang.
Lernen wie kleine Kinder
Die Hardware wird den Forschern bei der Entwicklung smarter Maschinen eher wenige Beschränkungen auferlegen, doch wie sieht es mit der Software und der Effzienz und Effektivität der Informationsverarbeitung aus? Hier scheinen noch lange nicht die besten Lösungen gefunden worden zu sein: Während etwaDeep-Learning-Systeme Zigtausende bis Millionen von Katzen sehen müssen, um danach eine Katze zuverlässig zu erkennen, reichen kleinen Kindern ein paar Dutzend Lernbeispiele, um auch einen gestiefelten Kater oder den König der Löwen als Katze einzustufen. In diesem Sinne erreichen Kinder ihre Lernziele wesentlich wirkungsvoller und wirtschaftlicher als Computer. Zudem sind Deep-Learning-Systeme nur Meister im Vergleich von Mustern, nicht mehr. Wenn sie etwa auf Tierbilder trainiert wurden, fnden sie überall Tiere, auch in Wolken oder dem Rauschen eines Bildschirms – was dann wie Halluzinationen von Computern wirkt. Ihnen fehlen völlig das Hintergrundwissen und das Verständnis für Zusammenhänge.

Mehr noch: Wenn man die Frage beantworten will, wie intelligent Maschinen werden können, muss man erst einmal klären, von welcher Intelligenz die Rede sein soll. Denn Fachleute sprechen von mathematischer, räumlicher, sprachlicher, logischer, emotionaler oder sozialer Intelligenz – unsere Intelligenz ist nicht nur das, was der IQ misst. So kann ein Neuronales Netz zwar Objekte aller Art erkennen, aber es weiß nichts über deren Bedeutung für den menschlichen Alltag. Außerdem gilt nach wie vor der alte Spruch „Computern fällt leicht, was Menschen schwerfällt – und umgekehrt“. Das gilt nicht nur für Computer, sondern auch für Roboter. Türen öffnen und Bälle fangen, laufen und Hindernissen ausweichen, das gehört alles zu den leichtesten Aufgaben, die man einem körperlich gesunden Menschen stellen kann, aber gleichzeitig zu den schwierigsten Aufgaben für Roboter.
Auch Menschen müssen ihre Fähigkeiten erst nach und nach erwerben. In den ersten beiden Lebensjahren entsteht zunächst die sensomotorische Intelligenz: Babys lernen krabbeln, stehen, laufen, nach Dingen greifen und ihre Bewegungsabläufe koordinieren. In den Jahren danach entwickeln sich sowohl das Sprechvermögen wie die symbolische Vorstellungskraft und die Fähigkeit zur Empathie. Zugleich lernen Kinder immer besser, vorauszudenken und ihr Handeln zu planen, doch erst mit elf oder zwölf Jahren sind Jugendliche in der Lage, Probleme systematisch zu analysieren, Hypothesen und kreative Lösungen zu entwickeln und über sich selbst nachzudenken.
Einen ähnlichen Weg gehen Forscher nun mit Maschinen. Sensomotorische Intelligenz haben die besten Roboter schon entwickelt: Sie können einigermaßen sicher stehen, laufen und Dinge aller Art greifen. Der vierbeinige Roboter Cheetah von Boston Dynamics rennt schneller als Usain Bolt, der schnellste Mensch über die 100- und 200-Meter-Distanz – und es gibt bereits feinfühlige Roboter, die weiche Erdbeeren pflücken, ohne Druckstellen zu hinterlassen.
Auch das Lernen durch Beobachten und Nachahmen, das kleine Kinder so gerne einsetzen, bringt man nun Robotern bei. Beispielsweise sollen die gerade auf den Markt kommenden „kollaborativen Roboter“ lernen, mit Menschen Hand in Hand zu arbeiten. Eine herkömmliche Programmierung ist nicht mehr nötig. Stattdessen führt man einfach die Arme und Greifer solcher Roboter und zeigt ihnen, wie sie Knöpfe drücken oder Bauteile montieren sollen. Diese Maschinen sind so sensibel, dass sie in Bruchteilen von Sekunden eine Bewegung stoppen, wenn ihnen ihre Sensoren mitteilen, dass sie andernfalls einen Menschen verletzen könnten.
Ein Höhepunkt menschenähnlicher Technik sind Androiden, wie sie von Hiroshi Ishiguro in Japan gefertigt werden, oder der humanoide Roboter Sophia des Hongkonger Unternehmens Hanson Robotics. Sophia, die dank Gesichtserkennung, einer Chatbot-Funktion und der Imitation von Gestik und Mimik einfache Gespräche führen kann, redete im Oktober 2017 als erster Roboter vor den Vereinten Nationen und bekam anschließend sogar die Staatsbürgerschaft von Saudi-Arabien verliehen. Mit dem Moderator Jimmy Fallon spielte sie live im Fernsehen „Schere, Stein, Papier“ und witzelte, dass sie seine US-Talkshow „The Tonight Show“ übernehmen könnte.
Entscheidend ist die Qualität der Lehrer
Selbst das Lernen durch Belohnungen findet schon Eingang in die Welt der smarten Maschinen: Natürlich bekommen sie nicht wie Kinder Schokolade oder gute Noten, sondern ihnen genügt ein internes Punktekonto, das aufgefüllt wird, wenn sie etwas richtig gemacht haben, oder ein Schulterklopfen oder Lächeln, das sie mithilfe ihrer Kameras und Sensoren wahrnehmen und als Lob werten.

Entscheidend ist dabei – wie bei Menschen auch – die Qualität der Lehrer. Ein misslungenes Beispiel war der Chatbot Tay, der im Frühjahr 2016 lernen sollte, wie sich Menschen im Internetunterhalten. Binnen 24 Stunden musste Microsoft ihn wieder vom Netz nehmen, weil er zum Rassisten geworden war, der den Holocaust leugnete und Hitler lobte. Dieses Programm hatte ganz offensichtlich von den falschen Leuten gelernt. Wie man zuverlässige und sich ethisch korrekt verhaltende, selbstlernende Maschinen baut, wird sicherlich in Zukunft eine wichtige Aufgabe sein und neue Berufszweige eröffnen. Die ersten Lehrstühle für Maschinenethik existieren bereits.
Das Ziel der Forscher ist klar: Roboter und smarte Maschinen aller Art sollen einmal in der Lage sein, Menschen auch in komplexen, sich ständig ändernden Umgebungen zu helfen – wie perfekte Butler, ob beim Aufräumen oder Putzen zu Hause, beim Kochen oder Einkaufen oder beim Autofahren im Stadtverkehr.
Dass sie dafür noch sehr viel hinzulernen müssen, ist klar, doch einen wesentlichen Vorteil haben sie: Was eine Maschine einmal gelernt hat, kann sie im Prinzip in Zukunft in ein RoboNet hochladen und anderen Maschinen ähnlichen Bautyps zur Verfügung stellen – egal ob es darum geht, wie man Fenster putzt, einen Dinnertisch deckt oder einen Hubschrauber fliegt. Menschen hingegen müssen alles individuell lernen und können sich neue Fähigkeiten nicht einfach wie Apps herunterladen.
Müssen wir deshalb Angst vor einer Superintelligenz haben?
Dagegen sprechen ganz fundamentale Probleme: Maschinen, wie ausgeklügelt sie auch sein mögen, fehlt unser Alltagswissen, der „gesunde Menschenverstand“, und vor allem haben sie keinen biologischen Körper. Sie werden daher nie alle Erfahrungen mit Menschen teilen können: Sie müssen nicht essen und trinken, schlafen und träumen, sie wachsen nicht und bekommen keine Kinder, sie sind nicht kreativ, haben keine Intuition und Empathie und sie kennen den Sturm der Gefühle nicht, der Menschen ergreifen kann. Daher sei die Vorhersage gewagt: Selbst wenn smarte Maschinen Emotionen aus Gesten und Mimik lesen und wenn sie so tun, als ob sie Gefühle hätten, eine den Menschen vergleichbare emotionale und soziale Intelligenz wird ihnen verwehrt bleiben. Aus all diesen Gründen gehört eine Maschine, die uns Menschen auf allen Gebieten überflügelt, wohl eher in den Bereich der Science-Fiction als zu den realen Gefahren.
Wer macht die Arbeit von morgen?
Viel mehr Sorgen müssen wir uns allerdings um zwei andere Entwicklungen machen: um autonome Kampfroboter und um die Auswirkungen auf Arbeitsplätze. Das erste Problem lässt sich nur lösen durch eine weltweite Ächtung dieser Maschinen, wie es bei Biowaffen oder Atombomben im Weltall gelungen ist. Erste internationale Anstrengungen in diese Richtung gibt es bereits, aber sie müssen intensiviert werden. Auch dass sich durch den Einsatz von smarten Maschinen mit Künstlicher Intelligenz praktisch alle Jobs – egal in welcher Branche – erheblich verändern werden, ist offensichtlich. Vor allem Routinetätigkeiten in den Büros, bei denen es um die Beschaffung und Verarbeitung von Informationen geht, können künftig durch Maschinen übernommen werden:
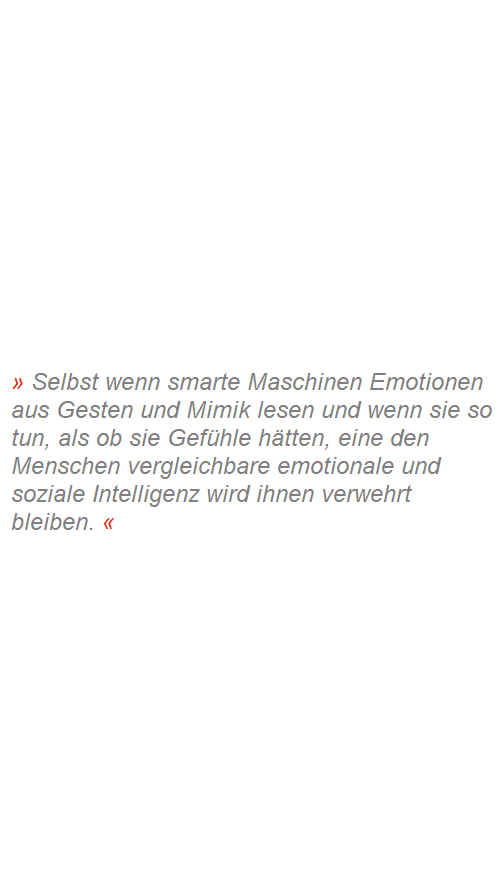
Das betrifft den Buchhalter ebenso wie den Steuerberater, den Logistiker oder Finanzanalysten. Ähnliches gilt für Putzkräfte, Lagerarbeiter oder Lkw-, Bus- und Taxifahrer.
Wenig betroffen sind hingegen kreative Jobs wie Forscher, Designer und Künstler sowie Berufe, die eine hohe Sozialkompetenz erfordern, wie Pflegekräfte, Lehrer und Manager. Zudem werden sich zwar viele Jobbeschreibungen verändern, aber nicht unbedingt die Arbeitsplätze wegfallen. So werden in Zukunft Ärzte die Hilfe von Computerassistenten in Anspruch nehmen, aber sie werden nicht durch Roboter ersetzt – allein schon deshalb, weil oft die Intuition der Ärzte und der Kontakt mit den Patienten der halbe Weg zur Heilung sind. Kurz gesagt: Die einfacheren Arbeiten machen Maschinen, die komplexeren die Menschen, die weiterhin als Lenker und Denker gebraucht werden, als Planer und Entscheider, als kreative Problem- und Konfliktlöser, als diejenigen, die Qualität und Sicherheit gewährleisten, und als die entscheidenden Partner, die emotionale und soziale Intelligenz gegenüber ihren Kunden und Zulieferern beweisen müssen.
Hinzu kommt, dass auch eine Menge neuer Berufe entstehen. Die smarten Maschinen müssen auch erst einmal entworfen und konstruiert werden, es muss sichergestellt werden, dass sie gefahrlos und zuverlässig betrieben werden können, und sie müssen trainiert und auf die Einsatzfelder optimal angepasst werden. Der Blick in die Vergangenheit bestätigt, dass neue Technologien immer auch neue Berufe mit sich bringen: Anfang der 1980er-Jahre, als die Computer massentauglich wurden, gab es noch so gut wie keine Software-Entwickler – heute sind es weltweit über 20 Millionen.
Mein Fazit lautet daher: Smarte Maschinen mit Künstlicher Intelligenz sind zweifellos eine der größten technisch-wirtschaftlich-sozialen Herausforderungen, vor denen die Menschheit derzeit steht. Aber sie sind auch eine Chance für all die globalen Aufgaben, die wir bewältigen müssen: ob im Kampf gegen den Klimawandel und beim Umbau der Energiesysteme, ob bei der Gestaltung lebenswerter Städte oder bei der Unterstützung der wachsenden Zahl pflegebedürftiger Menschen. Wenn wir es richtig machen, werden uns die smarten Maschinen weit mehr nützen als schaden.
Dr. Ulrich Eberl
ist Industriephysiker, Zukunftsforscher und einer der renommiertesten Wissenschafts- und Technikjournalisten Deutschlands. Er promovierte an der Technischen Universität München in Biophysik, arbeitete bei Daimler und leitete 20 Jahre lang bei Siemens die Kommunikation über Forschung, Innovationen und Zukunftstrends, bevor er sich 2016 mit einem Redaktionsbüro selbstständig machte. Zudem war er Gründer und Chefredakteur des international mehrfach ausgezeichneten Zukunftsmagazins „Pictures of the Future“.
2011 veröffentlichte er das Sachbuch „Zukunft 2050“, gefolgt von „Smarte Maschinen – wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändern wird“ im Sommer 2016.


